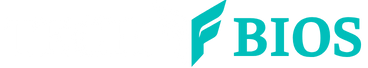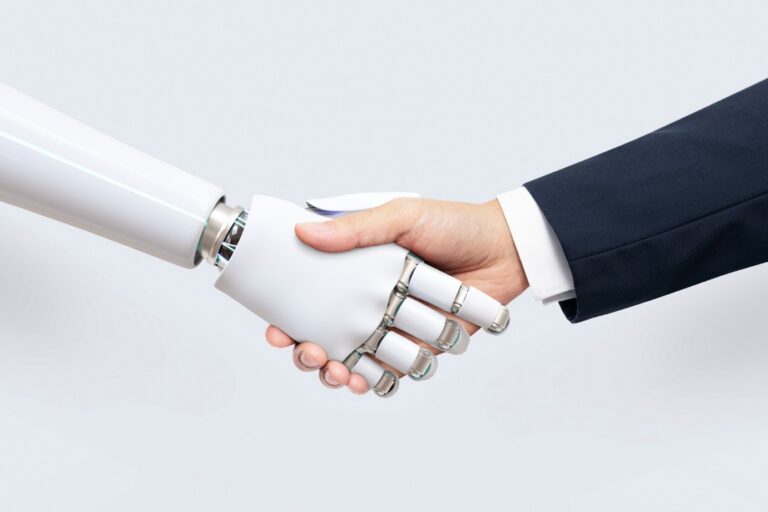In vielen Industrieunternehmen ist die Digitalisierung längst kein abstraktes Zukunftsthema mehr, sondern tägliche Realität – allerdings oft mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Während Maschinenparks modernisiert und ERP-Systeme erneuert werden, bleiben interne Prozesse überraschend häufig analog: Papierformulare, Excel-Listen, Fotos auf Diensthandys, Ablagen in lokalen Ordnern.
Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, Energiepreisdruck und strenger werdenden Regularien stellt sich die Frage, wo eigentlich die größten Effizienzreserven liegen. Und ob die Antwort wirklich immer in neuen Großsystemen zu suchen ist oder in den Kleinigkeiten, die den Alltag der Mitarbeitenden bestimmen.
Ein Blick in die Praxis: Digitalisierung ohne großen Projektapparat
Ein aktuelles Beispiel liefert der Chemiespezialist Alzchem. Das Unternehmen hatte eine Situation, wie sie in vielen mittelständischen Industriebetrieben typisch ist: Die dokumentationsintensiven Prozesse waren über Jahre gewachsen, stark papierbasiert und in Teilen nur durch Erfahrungswissen abgesichert. Die IT war dabei weniger das Innovationshindernis, sondern schlichtweg ausgelastet. Neue Digitalisierungsprojekte standen in Konkurrenz zu Wartung, Support und den Anforderungen großer Systeme.
Die grundlegende Frage lautete: Wie lassen sich Abläufe modernisieren, ohne zusätzliche Last auf den Schultern der IT? Und wie gelingt Digitalisierung, wenn Fachbereiche nicht länger warten wollen, bis Kapazitäten frei werden?
Ein Experiment im Versand mit unerwarteter Dynamik
Die Lösung begann nicht mit einem Masterplan, sondern als kleines Experiment. Im Bereich Versanddokumentation sollte geprüft werden, ob prozessnahe digitale Anwendungen auch ohne Programmierung entstehen können: schnell, pragmatisch, ohne zusätzliche Systemkomplexität.
Die gewählte No-Code-Plattform, smapOne, war dabei zunächst nur Mittel zum Zweck: ein Werkzeug, das Mitarbeitenden die Möglichkeit gab, Abläufe selbst digital abzubilden. Doch aus dem Pilot-Projekt wurde innerhalb kurzer Zeit ein Modell, das unternehmensweit Schule machte.
Inzwischen gibt es bei Alzchem über 85 Anwendungen, die von rund 600 Mitarbeitenden genutzt werden. Die Einsparungen summieren sich auf mehr als 8.800 Arbeitsstunden und das in Prozessen, die zuvor als „gegeben“ galten.
Der Verladecheck zeigt, wie tiefgreifend solche Veränderungen wirken können: Früher führte ein Mix aus Papierlisten, Digitalkamera und manueller Dateiablage regelmäßig zu Medienbrüchen und Nacharbeit. Heute entsteht der gesamte Nachweis digital, revisionssicher und mit klarer Prozessführung. Für ein einzelnes Verfahren bedeutet das ein Plus von rund 466 Arbeitsstunden pro Jahr.
Was wirklich überrascht: der kulturelle Effekt
Dass digitale Tools Prozesse beschleunigen können, ist wenig überraschend. Interessant wird der Fall jedoch durch die kulturelle Veränderung, die angestoßen wurde.
„smapOne haben wir bei uns superschnell angenommen. Vor allem weil die Plattform so einfach zu bedienen ist und wir damit unglaublich viele Abläufe anpacken können. Auf einmal stehen die Leute da, scharren mit den Hufen und wollen ihre eigenen Prozesse digitalisieren.“, berichtet Florian Kirchleitner, Digitalisierungsmanager bei Alzchem.
Diese Dynamik beschreibt einen Effekt, den viele Digitalstrategen kennen, aber selten konkret beobachten: Wenn Mitarbeitende plötzlich Werkzeuge haben, um Probleme selbst zu lösen, verändert sich der Blick auf Prozesse grundlegend. Aus passiver Erwartungshaltung wird gestalterisches Handeln. Und genau dieser Wandel sorgt dafür, dass Digitalisierung nicht mehr als externes IT-Projekt wahrgenommen wird, sondern als Teil der eigenen Arbeit.
Warum Effizienzlücken selten im Code liegen
Was CIOs aus diesem Beispiel mitnehmen können, ist weniger ein Tool-Tipp, sondern eine strukturelle Erkenntnis: Die größten Engpässe entstehen oft nicht in den großen Systemen, sondern in den analogen Zwischenräumen.
Dort, wo Dokumente wandern, Dateien abgelegt werden, Unterschriften gesammelt oder Daten manuell übertragen werden, entstehen Reibungsverluste – unsichtbar, aber wirksam.
Wer an diesen Stellen ansetzt, braucht nicht zwingend komplexe Softwarearchitekturen, sondern klare Governance und standardisierte Ansätze, mit denen Fachbereiche selbst Lösungen entwickeln können, ohne die IT zu überlasten.
Das Projekt bei Alzchem zeigt: No Code kann eine solche Architektur sein – nicht als Ersatzsystem, sondern als Ergänzung, die Freiräume schafft und strukturelle Last aus der IT herausnimmt. Die Plattform wird dabei nicht als Produkt, sondern als Prozessbaukasten verstanden, der innerhalb definierter Regeln flexibel genutzt werden kann.
Der größere Trend dahinter
Was hier in einem mittelständischen Chemieunternehmen passiert, ist Teil einer breiteren Entwicklung: Unternehmen suchen Wege, um Digitalisierung skalierbar zu machen, ohne in jedem Fall neue Entwicklungsressourcen oder externe Dienstleister zu benötigen. No Code und Low Code rücken in diesem Kontext stärker in den Fokus – nicht als „Shortcut“, sondern als ernstzunehmender Bestandteil moderner IT-Strategien.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand:
- Fachkräftemangel erhöht den Druck auf IT-Abteilungen
- Compliance-Anforderungen verlangen dokumentierte, auditfähige Abläufe
- Agilität wird wichtiger, aber schwer durchsetzbar, wenn Projektlaufzeiten lang sind
- Fachbereiche wollen sichtbar Verantwortung in der digitalen Wertschöpfung übernehmen
No Code bietet hierfür eine Möglichkeit – nicht immer, nicht überall, aber dort, wo Prozesse nahe
am Menschen stattfinden und schnell weiterentwickelt werden müssen.
Digitalisierung beginnt im Kleinen – und gewinnt im Großen
Der Fall Alzchem zeigt, dass Digitalisierungsprojekte nicht zwingend mit großen IT-Programmen starten müssen. Manchmal reicht ein kleines, klar abgegrenztes Experiment, um Strukturen in Bewegung zu bringen.
Wenn Fachbereiche befähigt werden, eigene Lösungen zu entwickeln, entstehen nicht nur effiziente Prozesse – es entsteht eine neue Verantwortungskultur, die Digitalisierung zu einem gemeinsamen Projekt macht.
Für Unternehmen, die heute nach Wegen suchen, ihre Effizienz zu steigern und trotzdem flexibel zu bleiben, könnte genau hier der entscheidende Hebel liegen.